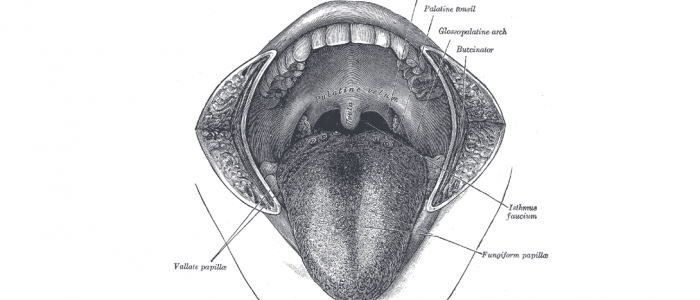Wie gendern?
Wenn es um die Frage geht, wie Texte gegendert werden sollen, geraten sehr schnell sämtliche Maskulina ins Visier der Genderratgeber, die dann mit Stumpf und Stil „neutralisiert“ werden. Doch man muss mitnichten jeden Text zwanghaft und bis ins Letzte mit Partizipien vollstopfen und mit Gender*sternen und Gender:doppelpunkt zersieben, um ausgewogene Assoziationen in den Vorstellungen der Leserinnen und Leser zu wecken. Es geht auch anders.
Das sture Durchgendern eines Textes mit konstanter Beidnennung oder Binnen-I (und erst recht mit Genderstern und Genderdoppelpunkt) führt zu einer „Überfrachtung der Sprache mit Gendersignalen“, meint die mittlerweile emeritierte österreichische Universitätsprofessorin Maria Nicolini in ihrem lesenswerten Buch „Das unterschätzte Vergnügen. Schreiben im Studium“. Jeder Mensch, der nur einen Hauch der ästhetischen Lust empfinden kann, den ein gut formulierter Text auslöst, wird ihr zustimmen. Nicolini regt an, Genderfälle in Texten zu verringern, so gut es geht. Beispiele dafür: Man schreibt „alle“ statt „jeder/jede“, „Fachleute“ statt „Expertinnen und Experten“, „Lehrkräfte“ statt „Lehrerinnen und Lehrer“. Wenn man darauf achtet, lassen sich viele Doppelnennungen vermeiden. Aber die Methode hat ihre Grenzen, denn vielfach wirken die eingeführten Formen blutleer: eine „Lehrperson“ geht uns weniger nahe als ein Lehrer oder eine Lehrerin, ein Mitarbeitender wirkt weniger präsent als ein Mitarbeiter. Überhaupt sind die seit den 2010er-Jahren gehäuft auftretenden Wortbildungen im Partizip Präsens (Studierende, Teilnehmende, Zu-Fuß-Gehende etc.) nicht nur umstritten, da sie Bedeutungen verschleifen, sie werden, wie eine Grazer Studie aus dem Jahr 2023 gezeigt hat, auch von Deutschlernern deutlich schlechter verstanden als andere Genderformen. Doch kein Grund zum Jammern, denn auch diese Hürde lässt sich überwinden, wobei eine zweite Taktik zur Anwendung gelangen kann.
Schlüsselwörter
Wenn wir einen Text lesen, beeinflussen Schlüsselwörter, wie wir den Inhalt auffassen. Dabei ist es entscheidend, wann uns diese Wörter im Text begegnen: Tauchen sie früh auf, beeinflussen sie die Richtung, in die wir denken. Diese Spielart des sogenannten Primings lässt sich fürs Gendern nutzen. Das möchte ich an einem Beispiel zeigen, auf das ich unlängst bei einem Lektorat stieß. Es ging in diesem, von einer Apothekerin verfassten, Text um die pharmazeutische Begleitung von Suchtabhängigen. Das Beispiel lautet:
- „Die Hauptaufgabe der Apotheken liegt in der Abgabe des Substitutionsmittels sowie in der pharmakologischen Betreuung der Patientinnen und Patienten. Kommt ein Substitutionspatient mit Rezept in die Apotheke, hat er zuvor bereits zahlreiche Stationen durchlaufen.“
Im ersten Satz ist die Personenbezeichnung mit Beidnennung gegendert („Patientinnen und Patienten“). Im zweiten Satz wird das generische Maskulinum verwendet – weil durch die Beidnennung im Satz davor hinlänglich klar ist, dass mit dem „Substitutionspatient“ Pars pro toto alle angesprochen sind.
In einem anderen Lektorat, das ich für das Graz-Museum abwickelte, stand über ein historisches Gefängnis am Grazer Schlossberg zu lesen:
- „Schwerverbrecher – Männer wie Frauen – wurden in den Kellern angeschmiedet. Die Insassen erlitten Hunger und Torturen.“
In diesem Beispiel verdeutlicht der Zusatz „Männer wie Frauen“ eindeutig, dass das generische Maskulinum als generisches Humanum („der Mensch“) zu lesen ist. Im zweiten Satz ist daher klar, dass mit den „Insassen“ ebenfalls Männer und Frauen umfasst sind.
Moderate Beidnennung als Königsweg
Mit anderen Worten: Als eleganteste Vorgangsweise fürs Gendern kann man möglichst früh in einem Text die Beidnennung verwenden oder auf andere geeignete Weise Männer und Frauen ansprechen. Das wiederholt man alle drei bis vier Absätze und ruft so immer wieder in Erinnerung, dass der Text von Menschen jeglichen Geschlechts erzählt. In den Sätzen und Absätzen dazwischen darf man sich darauf verlassen, dass durch den Priming-Effekt alle Leser das grammatische Maskulinum als generisch – also geschlechtsneutral – auffassen. (Zumindest so lange sie kein maschinelles Sprachverständnis ihr Eigen nennen oder/und zu dogmatischen Sprechakten neigen.)
Man kann diese Methode als „moderate Beidnennung“ bezeichnen. Sie führt, wie eine kognitionspsychologische Studie (Rothmund & Scheele, 2004) zeigt, zu einer „sexussymmetrischen Assoziationen“ – mit anderen Worten: zur ausgewogenen Repräsentation von Männern und Frauen in der Vorstellungswelt der Leserinnen und Leser. Und das selbst dann, wenn der Text über weite Strecken vom generischen Maskulinum getragen wird.
Verdoppelungen ermüden
Die moderate Beidnennung wurde lange Jahre auf Ö1 gepflegt. Leider haben sich manche ORF-Moderatoren dafür entschieden, auf die konsequente Beidnennung umzusteigen. Seither begegnet man im Radio und TV manchmal Beiträgen, wo die Personenform gnadenlos verdoppelt wird – bis hin zum „Staatsbürgerinnen- und Staatsbürgerschaftsnachweis“, um den es in einer Ö1-Sendung mal eine geschlagene Stunde lang ging, stets unter redundanter (und nebenbei: inhaltlich falscher) Verdoppelung der Dokumentenbezeichnung.
Das konsequente Beidnennen unterschätzt sowohl die metaphorische Ebene der Sprache als auch das intuitive Sprachverständnis der Menschen und hat einen zwanghaften Beigeschmack. Das zeigen auch unsere beiden Beispiele, wenn man sie entsprechend ändert:
- „Schwerverbrecherinnen und Schwerverbrecher wurden in den Kellern angeschmiedet. Die Insassinnen und Insassen erlitten Hunger und Torturen.“
- „Die Hauptaufgabe der Apotheken liegt in der […] Betreuung der Patientinnen und Patienten. Kommt eine Substitutionspatientin / ein Substitutionspatient mit Rezept in die Apotheke, hat er/sie zuvor bereits zahlreiche Stationen durchlaufen.“
Das klingt viel unnatürlicher als die ursprünglichen Sätze, die nahe am gesprochenen Deutsch waren. Das starre Gendern mit Beidnennung führt dazu, dass man beim Lesen mit der Zeit die zweitgenannte Form überspringt und vom Text zunehmend unterfordert ist. Durch die dauernde Verdoppelung gewinnt man keine Information dazu, sondern wird lediglich mit Formalitäten behelligt. Die Sprache wird starr und redundant und geht unter den Genderformen in die Knie.
Das Problem der Überwucherung
Auch neigt die konsequente Beidnennung zu Überwucherungen. So sieht man in Firmentexten oft Wörter gegendert, mit denen gar keine realen Personen bezeichnet werden. Typisch sind etwa „Unternehmenspartnerinnen und -partner“, wenn andere Firmen gemeint sind. Aber dass es bei einer GmbH auf das Geschlecht ankäme, wäre mir neu. Eine andere zwanghafte Konsequenz ist es, übertragene Bedeutungen stur zu duplizieren, sobald die Metapher auch nur entfernt nach generischem Maskulinum riecht – etwa den „Königsweg“ aus dem Zwischentitel oben in einen „Königs- und Königinnenweg des Genderns“ zu verdoppeln. Das kann lustig sein, aber auf Dauer wirkt es sektiererisch.
Wie schaut es aus mit dem Binnen-I?
Das Binnen-I bringt gegenüber der sturen Beidnennung eine Verbesserung, weil es die Redundanzen vermeidet – aber nur dann, wenn man in der Mehrzahl bleiben kann:
- „SchwerverbrecherInnen wurden in den Kellern angeschmiedet. Die InsassInnen erlitten Hunger und Torturen.“
- „Die Hauptaufgabe der Apotheken liegt in der […] Betreuung der PatientInnen. Kommt einE SubstitutionspatientIn mit Rezept in die Apotheke, hat er/sie zuvor bereits zahlreiche Stationen durchlaufen.“
Im Singular treibt das Binnen-I etliche der grausigsten Blüten des Genderdeutsch. Mit Wörtern, die in Verbindung mit dem femininen „-in“ im Stamm einen Umlaut bilden (Arzt/Ärztin), gerät es völlig außer Kontrolle (AErztIn?). Im Übrigen ersetzt die Form mit Binnen-I das als ungerecht geschmähte generische Maskulinum einfach durch ein generisches Femininum. Deutlich wird das, wenn der Plural des Ausgangswortes nicht auf „-er“ endet. Dann nämlich wird die männliche Form strenggenommen ausgespart, denn weder „die Patient“ noch „die Insass“ oder beispielsweise „die Ärzt“ sind dem Lexikon bekannt. Dass mit diesen Formen die sprachliche „Gerechtigkeit“ oder „Sensibilität“ befördert werden soll, ist ein Wunsch aus dem Träumeland.
Und wie steht’s mit dem Genderstern?
Der Genderstern soll in jeder Textäußerung die Tatsache in Erinnerung rufen, dass es Menschen gibt, deren Geschlecht sich nicht eindeutig dem Schema männlich/weiblich zuordnen lässt bzw. die ihr Geschlecht wechseln und/oder andere sexuelle Interessen verfolgen als die heterosexuelle Mehrheit. So begrüßenswert dieses Anliegen gesellschaftspolitisch ist, so aufdringlich ist die Umsetzung, wenn Wörter mit Sternen penetriert werden:
- „Schwerverbrecher*innen wurden in den Kellern angeschmiedet. Die Insass*innen erlitten Hunger und Torturen.“
- „Die Hauptaufgabe der Apotheken liegt in der […] Betreuung der Patient*innen. Kommt ein*e Substitutionspatient*in mit Rezept in die Apotheke, hat er/sie* zuvor bereits zahlreiche Stationen durchlaufen.“
Der Genderstern stößt die Leser andauernd mit der Nase auf die Frage nach der sexuellen Orientierung bzw. Geschlechterzugehörigkeit und stört dadurch das Textverständnis massiv. Wenn, bezogen auf unser Beispiel, Hetero-, Homo- oder Bisexualität eine Rolle bei der Behandlung von Suchterkrankungen spielte, dann wäre dies eigens im Text erwähnt worden. Wenn es aber für die Therapie bedeutungslos ist, wie Suchtkranke ihr Liebesleben gestalten, was soll dann der Stern in diesem Text? Er lenkt vom Eigentlichen ab. Detto bei den Insassen im Foltergefängnis der frühen Neuzeit. Hier kann man sich fragen: Geht es im Text um die elenden Haftbedingungen im Kerker oder vorrangig um die Frage, ob auch Intersexuelle angeschmiedet waren? Der Stern suggeriert Zweiteres, legt dadurch den Text in Ketten und unterzieht die Leser der Tortur der peinlichen Gender-Befragung. Und das ist bei so gut wie jedem Thema der Fall.
Folgende Gründe sprechen gegen den Genderstern:
- Der Stern zersiebt Texte und lenkt den Blick weg vom Inhalt auf den Asterisk, der bisher Fußnoten-Verweisen oder Unanständigem vorbehalten war.
- Der Genderstern ist nicht barrierefrei: Auf Websites und in Dokumenten wird er von Sprachausgabeprogrammen als „-stern-“ ausgelesen: „Schwerverbrechersterninnen wurden in den Kellern angeschmiedet. Die Insasssterninnen litten Hunger und Durst.“ Das bedeutet: Das „gendersensible“ Schreiben wirkt hochgradig exkludierend, was nicht im Sinn der Anwender sein kann.
Den Blick wieder aufs große Ganze richten
Als Humanist bin ich der Überzeugung, dass den Menschen als Spezies insgesamt mehr ausmacht als seine sexuelle Orientierung, sein jeweiliges biologisches Geschlecht und die kulturelle Ausprägung der Geschlechterrollen. Die permanente Betonung von Genderformen dagegen rückt die Gendersonne in den Mittelpunkt, als gäbe es den Menschen nicht, sondern als wäre jedes Geschlecht seine eigene biologische Art, und als wäre es das Wichtigste der Welt, das Geschlecht permanent im Blick zu haben. Das mag für Sexual- und (Trans-)Genderberatungsstellen gelten; in allen anderen Zusammenhängen ist es überzogen.
Ein ähnliches Argument bringt auch Suhrkamp-Lektorin Katharina Raabe in einem lesenswerten Dialog mit der literarischen Übersetzerin Olga Radetzkaja an: „Einstweilen sollten wir vielleicht einen Schritt zurücktreten und unterscheiden: Ob ich eine Person anspreche, darauf bedacht, sie nicht zu verletzen, und mich dabei erlernter Wörter oder einer neuen Artikulation bediene; oder ob ich mit anderen über ein Thema rede, das weder mit Gender noch mit Diskriminierung zu tun hat, und auf die entsprechenden Markierungen verzichte – das ist zweierlei.“
Statt zu differenzieren fährt die gendersprachliche Dampfwalze über alle Äußerungen gleichermaßen drüber. Noch einmal Katharina Raabe: „Was wir derzeit sehen, ist, dass diese Unterscheidung scheinbar aufgehoben wird: Eine mit Idiosynkrasien befrachtete und mit den genannten Markierungen orthographisch und typografisch präparierte Sprache drängt sich immer stärker in alle Bereiche der Kommunikation hinein.“
Die feminine Seite der Sprache
„Idiosynkrasie“ zählt zu meinen Lieblingsfremdwörtern. Man kann es mit „Überempfindlichkeit“, hier aber auch mit „Voreingenommenheit“ übersetzen. Die Gendersprache ist in dem Sinn idiosynkratisch, als sie völlig auf die vermeintliche „Ungerechtigkeit“ des Deutschen fixiert ist. Dadurch übersieht sie die feminine Seite unserer Muttersprache völlig – z. B. dass es unter den Hauptwörtern im Deutschen zahlenmäßig mehr Feminina (45 %) als Maskulina (34 %) oder Neutra (21 %) gibt. Oder: Dass Hauptwörter im 1. Fall plural immer vom weiblichen Artikelwort „die“ begleitet werden, weswegen z. B. manche Menschen glauben, dass Speisen wie „die Krautfleckerl“ Feminina wären. Ebenso gerne wird übersehen, dass die neutralen Mehrzahl-Fürwörter „ihr“ und „sie“ deckungsgleich mit weiblichen Formen sind. Und dass es im Gegensatz zum weiblichen Suffix „-in“ kein gebräuchliches Suffix gibt, das ausschließlich die männliche Form anzeigen würde – dass also strenggenommen die Männer immer nur „mitgemeint“ sind.
Manisch-mechanisches Gendern
Forciertes Gendern ist von seinen Ursprüngen her ein akademischer Soziolekt, der von Gleichstellungsbeauftragten mit mangelndem Sprachverständnis während der letzten Jahre in sprachlichen Brutalismus verwandelt wurde. Dabei kommt das schöne Prinzip der „Überwucherung des Mittels über den Zweck“ zum Tragen: Das Gutgemeinte entgleitet ins Manisch-Mechanische und ufert aus. Die ersten Genderleitfäden der späten 1980er- und 1990er-Jahre wiesen zum Beispiel noch darauf hin, dass Erstglieder in Wortzusammensetzungen der besseren Verständlichkeit halber nicht gegendert werden sollten. 30 Jahre später sind „Staatsbürger:innennachweise“, „Bürger:innen-Beteiligungsprozesse“, „Patient:innen-Ombudsstellen“ und „Ärzt:innentagungen“ an der sprachlichen Tagesordnung. In Broschüren der öffentlichen Verwaltung wird penibel darauf geachtet, keine einzige Personenbezeichnung ungegendert in Druck zu geben.
Wer einen Ausweg aus der Misere sucht, sollte dazu beitragen, die Bedeutungen zu verschieben und dabei den Kontext nutzen, den ein Text als Ganzes ausmacht. Also z. B. in einem Text über Politiker oder Topmanager Männer wie Frauen und bei Bedarf auch Nonbinäre vorkommen lassen. Alternativ lässt sich auch zu sanften sprachlichen Adaptionen wie der hier beschriebenen moderaten Beidnennung greifen. Wichtig ist es dabei, die Fixierung auf einzelne Begriffe zu lösen, Texte wieder als größeres Ganzes zu sehen und generell mit mehr Menschenverstand als genderfeministischer Ideologie zu betrachten. Oder wie es die Linguistin Helga Kotthoff in einem Aufsatz aus dem Jahr 2022 formulierte: „Die stark im Pro und Contra geführte Debatte ließe sich dadurch entschärfen, dass das generelle Anliegen, in Texten etwas dafür zu tun, dass nicht überwiegend männliche Personen vor unser inneres Auge treten, anerkannt wird – wohlgemerkt: in Texten, nicht in Einzelsätzen.“
Vielleicht wird, wenn wir den Blick aufs große Ganze richten, die Sprache wieder zu etwas, das auch im Formulieren von Gebrauchstexten uneingeschränkt Freude bereiten kann und nicht länger an eine zwangsneurotische Ersatzhandlung erinnert. Wie heißt es so schön in Cordula Simons jüngstem Roman „Mondkälber“ (2024): „Ich erinnerte mich dunkel daran, dass Sprache dereinst Freude bereitet hatte.“